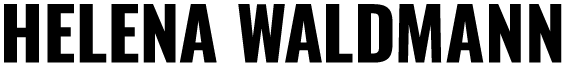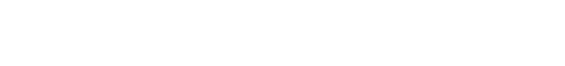see and be scene
- a catwalk banquet -
2000
„The better you look the more you see“
Bret Easton Ellis
This extremely intimate piece, inspired by Bret Easton Ellis‘ novel „Glamourama“, is showing a world in which everything is presentation and hype: the body, the sex, the information, the fashion, the product.
128 spectators sit at a 15 meter-long table. On the table three female Asian dancers, seducing, arousing and irritating the audience and 128 reflective plates, diverting the audiences glances.
Even that which is close enough to touch is illusory.
From the sexual body to the destruction of the body, all it takes is a smile.
The dancers‘ bodies wear a very special kind of fashion collection by media artist Alba D’Urbano, in which two-dimensional body-images are layered onto the three dimensional form of a costume as a copy of the latter to the first.
I think every seduction is always both: lies and conquest, terror and lust for love.
And fashion, another lie that conquers the body, is the purest form of terrorism.
Helena Waldmann
Helena Waldmann is a master of the mediaistic play of desire and delay; she plays with the illusion of seduction, the seductive power of illusion – and socks the onlooker in the eye.
128 Zuschauer sitzen auf Fahrradsattelstühlen um einen 15 Meter langen Laufsteg, wie an einem Tisch. Vor jedem liegt ein Spiegel, der nach Belieben benutzt werden kann.
Das Publikum ist haut- und hauchnah dabei, kaum eine Armlänge von ihnen entfernt agierten drei asiatische Tänzerinnen. Plötzliche Fuß- und Handaktionen stoppen keine Handbreit vor der Nase der Zuschauer. Inmitten des Publikums schlängeln sich die Tänzerinnen wiederholt vom Laufsteg herab um unter den Podesten zu verschwinden. Darüber hängt, gleichsam einem Dach, eine Projektionsfläche, deren Abmessung den Laufsteg spiegelt. Dort erscheinen Videobilder der Künstlerin Karina Smigla-Bobinski.
Alles ist vielfach miteinander verschaltet.
Was hinter und unter den weißen Mänteln steckt, welche die Tänzerinnen eingangs tragen, ist nur eine weitere bespiegelte Projektionsfläche. Knöpfen die Tänzerinnen die Mäntel auf, ‚tragen’ sie Körper: auf ihren hautfarbenen Anzügen, Shirts und Hosen (gestaltet von der Medienkünstlerin Alba D’Urbano) sind ‚ihre’ Körper aufgedruckt: Falten, Brüste, Schamhaar. Ziehen die Tänzerinnen die Jacketts aus, erscheint darunter das nächste Shirt mit aufgedrucktem Körper. Diese Körperhüllen lassen sich problemlos untereinander austauschen. Der scheinbar unmittelbar vor den eigenen Augen greifbare Körper entzieht sich so jeglicher Greifbarkeit: Helena Waldmann inszeniert Bodiescapes: präsent(iert)e Körper, die einem logisch-analytischen Zugriff entkommen, die sich statt gegenwärtig zu sein in permanentem Fluss befinden.
Noch bevor die Körper aus Fleisch und Blut die Bühne betreten, zeigen die Videoprojektionen fließende Wassertropfen, in denen die Körper der Akteure einkopiert sind. Blut ist im finalen Bild nur auf der Videoprojektion zu sehen, während eine Tänzerin behängt mit veritablen, riesigen Fleischlappen über die Bühne läuft. In den 60 Minuten dazwischen sind Körper längst zerflossen: Was bleibt, sind Zeichen. Und der Zuschauer ist bei all dem Voyeur – nicht zuletzt seiner selbst – wie auch und vor allem Akteur, der aktiv durch das Zeichennetz navigiert und sich dabei seiner interaktiven Rollen bei der Sinnzuschreibung bewusst ist.
a production of Berliner Festspiele: Berlin Offene Stadt ‘Spiel-Räume’ (D), Frankfurt Zweitausend (D), Podewil Berlin (D)
supported by Dezernat für Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main;
Senatsverwaltung für Forschung, Wissenschaft und Kultur, Berlin; Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst; Nassauische Sparkassen Stiftung ‘Initiative und Leistung’
Official Trailer – see and be scene | 8:30 min.
with
Kazue Ikeda
Yoko Tani
Chia-Yin Ling
choreography
Helena Waldmann
Chris Ho Chau Wah
stage installation
Helena Waldmann
Karina Smigla-Bobinski
video
Karina Smigla-Bobinski
music
live percussion
Arik Hayut
body-image collection
Alba D’Urbano
light design
Peter Müller
coats
Ulla Brennecke
meat dress
Nina Lepilina
assistant to director
Judith Brückmann
video post-production
Ute Schall
sound engineering
Stephan Wöhrmann
project management
Claudia Bauer
fotos
Bernd Uhlig
Karina Smigla-Bobinski
duration
60 minutes
Touring
Premiere:
2000, JULY 27
Berliner Festspiele in the Atrium of the House of German Commerce
Berlin (D)
2000
JULY 28-30
Berliner Festspiele in Atrium of the House of German Commerce (D)
SEPT 7-9
Podewil Berlin (D)
SEPT 12-13
Podewil Berlin (D)
SEPT 28-30
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt/Main (D)
OCT 1
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt/Main (D)
OCT 15+16
Muffatwerk München (D)
NOV 20+21
Theaterhaus Jena (D)
2002
APRIL 13+14
Alte Feuerwache Mannheim (D)
Press
english
ballet international/tanz aktuell | 10.2000
by Franz Anton Cramer
Enchanting amazones in Berlin >
Why always look straight ahead? Just because theaters been dictating a strict gaze ahead for the last 2500 years?
Helena Waldmann no longer believes in the central perspective as the only-true theatrical method. In her medial-visual installations, she well and truly stirs up the order of the gaze.
(…) So finally the gaze goes mad with its own desire, because ultimately the nudity remains hidden, aggressive and bloodthirsty. No one really knows if they’ve seen everything.
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 2000, July 10
Copies of naked skin under Kimonos >
As always in Waldmann’s shows, the audience is part of an experimental arrangement of things: they’re voyeurs on the one hand, while their own curiosity is being observed on the other. What Helena Waldmann stages with the aid of her audience is the interplay of seduction and power, superficiality and truth, the media version of things and the reality of them. Shadows, mirrors and projections shake our normal perception of things, force us to question, open up new ways of looking at things. This manipulation of our way of viewing reveals the beautiful world of appearances for what it is: a charming, stage-managed lie, a sublime form of terrorism.
Frankfurter Rundschau | 2000, Sept 30
by Dirk Fuhrig
Killer Geisha Girls >
Helena Waldmann aims to lay bare the world of fashion. The posing on one side, the mercilessness of the gazes to which the models are exposed on the other, are conveyed by the garments commissioned by media artist Alba D’Urbano and which denounce the marketability of the (female) body. Instead of flowers or patterns, she had the fabric printed with photos of parts of the body. The three dancers stretch out towards the onlookers and look them boldly in the eye – the only difference between them and real models is when their lipstick slips. At the end, one of them walks virtually naked down the catwalk, dressed only in two strips of flesh. There’s no denying that this ”catwalk banquet” is perfectly staged and flawless in composition.
Die Welt | 2000, Aug 1
by Antje Schmelcher
Dinner for everyone >
Helena Waldmann groups the audience around the catwalk for a banquet as if she were celebrating a Last Supper of the Vanities. The sloughing of the three dancers’ outer shell is horrible to witness. Curiously provocative and lustful, they lean down towards the audience until, with an abrupt grabbing of their necks, they’re seemingly hanged in their own robes. This is no Munchhausen-like trick to save themselves, but an image of dying angels who laboriously cast off their outer skins. Beneath them is a nakedness which, in the form of sexual organs printed on costumes by media artist Alba D’Urbano, gives merely an appearance of naturalness – as natural as the nakedness that is presented daily by the media as being genuine. Waldmann demonstrates how false and destructive this intimacy is through her dancers’ continued sloughing. At the end, the women carry their final skin off the catwalk tied up in small bundles.
TAZ Berlin |2000, July 29
by Christiane Kühl
Picture puzzles and peeping Toms >
At the start of the performance, the onlookers tend to concentrate on the mirrors that are everywhere, and in which one can see either the models, oneself or the other voyeurs reflected. This play with the background also leaves it up to the audience to decide what their role is in this marketing spectacle: accelerators or victims of development? It’s all a question of perspective. Intelligent play with perspectives is a speciality of the Frankfurt-based choreographer, who’s currently ”artist in residence” at the Podewil for a season
Der Tagesspiegel Berlin | 2000, July 27
by Sandra Luzina
Geisha girls, killer girls >
Helena Waldmann even stages the regard of the observer: It can make you feel highly uncomfortable. She is a master of the mediaistic play of desire and delay; she plays with the illusion of seduction, the seductive power of illusion – and socks the onlooker in the eye. Waldmann’s artistic strategy and the actions of dancers Kazue Ikeda, Yoko Tani and Chia-Yin Ling expose the theatre of seduction as being pure stage-managed superficiality.
german
ballet international/tanz aktuell | 10.2000
von Franz Anton Cramer
Bezaubernde Amazonen in Berlin >
Warum eigentlich immer geradeaus gucken? Nur weil das Theater seit 2500 Jahren den starren Blick nach vorn diktiert? Weil das barocke Guckkasten-Prinzip sich sogar noch beim Fernsehen, vor allem aber in den so genannten Neuen Medien wiederfindet? (Keine Seh-Haltung ist so erbarmungslos nach vorn fixiert wie der Dreiklang von Monitor, Maus und Mensch). Nur weil der Blick vor sich konstitutiv ist für die Ich-Bildung und das Spiegelstadium, also der erste Blick auf sich selbst im Spiegel, zugleich lebenslanges Trauma und prägend für die narzisstische Gesundung – nur deswegen also sollten wir im Theater noch immer alle vorausstarren?
Helena Waldmann glaubt nicht mehr an die Zentralperspektive als alleinig selig machendes Theatermittel. In ihren medialen Optik-Installationen bringt sie stattdessen die Ordnung der Blicke gehörig durcheinander. (…) So geht zuletzt der Blick an seinem eigenen Begehren irre, weil die Nacktheit aggressiv und blutrünstig verhüllt bleibt. Im Übrigen kann niemand wissen, ob er wirklich alles gesehen hat.
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 7.10.2000
Kopien nackter Haut unterm Kimono >
Wie stets bei Waldmann ist das Publikum Teil einer Versuchsanordnung, einerseits Voyeur, gleichzeitig selbst beobachtet in seiner Schaulust. Es ist ein Spiel von Verführung und Gewalt, von Oberfläche und Wahrheit, medialer Vermittlung und Realität, das Helena Waldmann mit ihrem Publikum inszeniert. Schatten, Spiegel und Projektionen erschüttern die normale Wahrnehmung, stellen in Frage, eröffnen neue Sichtweisen. Die Manipulation des Blickes entlarvt die schöne Welt des Scheins als das, was sie ist: als reizvolle Inszenierung der Lüge, als sublime Form des Terrors.
Frankfurter Rundschau | 30.9.2000
von Dirk Fuhrig
Killer Geisha >
Helena Waldmann möchte die Welt der Mode bloßstellen. Das Posing einerseits, die Unerbittlichkeit der Blicke andererseits, denen sich die Models ausgesetzt sehen. Dazu hat sie sich der Kleidungsstücke bedient, die die Künstlerin Alba D’Urbano anfertigen ließ, um die Käuflichkeit des (weiblichen) Körpers zu denunzieren. Statt mit Blumen oder Mustern bedruckte sie die Stoffe mit Fotos von Körperteilen. Die drei Tänzerinnen räkeln sich den Zuschauern entgegen, blicken ihnen kühl in die Augen und unterscheiden sich erst von den echten Models, als ihnen der Lippenstift verrutscht. Am Ende schreitet eine von ihnen fast nackt über den Steg, bekleidet lediglich mit zwei Fleischlappen. Dieses ‚catwalk banquet‘ ist zweifelsfrei perfekt inszeniert und einwandfrei durchkomponiert.
Die Welt |1.8.2000
von Antje Schmelcher
Dinner for everyone >
Als feiere sie ein Abendmahl der Eitelkeiten, hat Helena Waldmann das Publikum zu einem Bankett um den Laufsteg gruppiert. Grausam vollzieht sich die Auflösung der äußeren Hülle der drei Tänzerinnen. Seltsam provozierend und lustvoll biegen sie sich dem Publikum entgegen, bis sie mit einem plötzlichen Griff ins Genick sich selbst in der Neue Medien Künstlerin Alba D’Urbano bloß vorgibt, natürlich zu sein.
Ebenso natürlich wie die Nacktheit, die von den Medien täglich als eine ‚echte‘ inszeniert wird. Wie falsch und zerstörerisch diese Intimität ist, zeigt Waldmann durch den fortgesetzten Prozess der Häutung ihrer Tänzerinnen. Die letzte Haut tragen die Frauen schließlich zu einem kleinen Bündel verschnürt in ihren Händen vom Laufsteg.
TAZ Berlin |29.7.2000
von Christiane Kühl
Vexierspiel mit Voyeuren >
Die Zuschauer konzentrieren sich zu Beginn der Aufführung auf die an allen Plätzen ausliegenden Spiegel, mit denen man wahlweise die Models, sich selbst oder die anderen Voyeure reflektieren kann. Das Spiel mit dem Rahmen stellt auch die eigene Position im Vermarktungsspektakel frei: Beschleuniger oder Opfer der Entwicklung – alles eine Frage der Perspektive.
Intelligentes Spiel mit Perspektiven ist eine Spezialität der Choreographin, die nun für eine Spielzeit ‚artist in residence‘ am Podewil ist.
Der Tagesspiegel Berlin 27.7.2000
von Sandra Luzina
Die Geisha als Killergirl >
Helena Waldmann inszeniert die Blicke des Betrachters mit. Das kann ganz schön ungemütlich werden. Die Regisseurin beherrscht das mediale Spiel von Begehren und Aufschub, sie spielt mit der Illusion von Verführung, der Verführungskraft der Illusion – und haut aufs Auge. Waldmanns künstlerische Strategie und die Aktionen der Darstellerinnen Kazue Ikeda, Yoko Tani und Chia-Yin Ling enthüllen das Theater der Verführung als Inszenierung der reinen Oberfläche.
Essay
english
by Hanne Seitz
Troubled Bodies - Performing the Body as an Imperfect >
I am sitting at a very long table in the inner yard of the House of the German Economy. Summer 2000 in the city of Berlin. About 120 people and I are waiting for Helena Waldmann‘s Catwalk Banquet to be served. „see and be scene“, I decode the subtitle of the performance and spectate the scene there before my eyes. I feel stress arising in my body. The desire to see always touches the desire to be seen (…) The exchange of gaze marks the split within the subject (the loss of the Specular I of the Imagination) and between subject (the entry into the Social I of the Symbolic.ì (Phelan 1993:21) I feel the gap opening between me (as perceived by the others) and I (as perceiver). But something much more fundamental and uncanny than the difference between the Self and the Other seeps through a sensation of my body being split. My eye and I am prepared for the worst. What if nothing happens, if the scene to be seen is my inside, me and just everyone sitting at the table?
(Have not other performances of Waldmann brought me to the outermost? Lying on my back, for instance, as in „The Malady of Death“ /„Die Krankheit Tod“ (1993), nothing seperating me from my neighbor, watching the live-performance on the stage placed like second floor above my head, spectating from the souterrain so to speak.)
As if to interrupt the ongoing cycle of seeing and being seen and being a scene the performers appear at last ñ as table-dancers. Rhythms of a drum. The three Asian woman are doing their best to upset my whole theory of the imperfect body: Their almost identical, perfect bodies walk very slow, step by step, from one side of the table to the other looking at everyone in the audience. Every muscle in the foot that is just passing by (not even 30 cm from my nose) knows what to do. My hand almost touched the lithe toes if I had not pulled it away.
They not only look perfect, they smell perfect, they are perfect, over-perfect.
And I am quite astonished: They are real. And: They are beautiful.
But the distinct exposure does not at all present the body as if it were a container for sexual phantasy or a surface for aggressiv engagement.
The setting disrupts what may be called object-perception. The women appear to be models and yet there is something going on that makes them a not-not-model. It is in their eyes. As they are gazing at me, I feel the gaze I gave returing like a bumerang, turning my inside out.
This placeless crossing of the gazes not only opens the chiasmatic relation between the self and the other or between me and I, it touches much deeper something within (without) my body.
The Catwalk Banquet brings the Cartisian binaries of subject and object (…) into a consanguieous, interconnected relationship, whereby the body and world are experienced as one flesh (Garoian 1999:46).
The body I now feel is no longer guarantor of identity it seems to suggest an alteration. Not only am I catching a glimpse of what is called diffèrence (Derrida 1990), I am sensing flesh (Merleau-Ponty). Any perceiver being absorbed by what he sees is able to see himself, but for Merleau-Ponty the deeper sense of narcissm is: not how the others see from the outside the outline of the body we live in, but to be seen by it (Merleau Ponty 1994:183).
It is not the power of sight nor the reality of an object that makes visibility at all possible, but the intertwining of all forms of perception and relations.
The farther the nearer.
Beneath their kimonos the table-dancers wear skin-coloured, slacky-like body suits with printed on bottom, breasts and pubic hair. The main course will be tea, served with a smile and japenese-style. And for desert the geishas will turn into killer-girls, a metaphor.
For the past eight years Helena Waldmann has presented pieces with multimedia, especially interested in connecting the real and the virtual. In vodka konkav (1997), for instance, the audience sat before a big box, only able to look at the performance through a slit as in a peep show. In using both mirror and live-video the spectator hears and feels the real body, but he or she actually sees (like in Platon‘s cave allegory) only mirror-reflections.
This was still theater, but it created a new kind of illusion. Having reached this point, Waldmann either needed to make a big step and open the performance space again or start off making films. Obviously she sticked with theater.
Multimedia is still involved in her new piece, but the setting has changed. She is no longer provoking the limits of theater by creating virtual worlds; now her aim is to find out what at all seeing is about.
In the Catwalk Banquet we see huge video-projections on a horizontal screen high above the table. I must either lift my head or use the mirror (placed like a dish in front of me) to catch a glimps of what is going on up there.
Most uncanny are the huge waterdrops reflecting the faces of women (are they beyond or within?) flowing on an invisible surface, carving their way, popping, melting, making the captured faces look monstrous, crushed, distorted, and out of shape. Female eyes seem to look through their own tears, facing the scene being performed by the dancers down there for and by the gaze of the spectator.
I am the scene and I am the director, but I am not quite sure.
I see myself seeing and she up there (as if I was facing the in(ter)face) is marking my blind spot. A troubled body. I feel my inside/sight inverted ñ not able to make a difference between here (me as perceiver) and there (dancers as being perceived) anymore, not knowing who or what is seeing, where or what is the being seen.
I am put to the slash that lies between the perceiver/perveived. I feel the inbetween opening. And I feel stuck there ñ torn to and fro within this intersecting double circulation. I am facing the extreme, practicing myself in the aesthetic of abscence (Kamper). And suddenly I Ñknowì that the perfect body is the imperfect body.
The chiasmatic structure of perception allows counter-perception to suddenly break in, calls for what was not intended like the unbidden (and long forgotten) guest/ghost taking the opportunity to slip through the door, calling for attention, proclaiming authorization and partial ownership.
It is an awarenes of this interference that the Catwalk Banquet serves.
The farther the nearer, the more visible the more invisible, the more Self the more Other, the more vision the more body, the more answers the more questions.
The drama the women evoke (and reflect) with their tidy walk cannot be solved on the surface of images; in fact it cannot be solved at all.
This may be the essence of experiencing the flesh of the world: to face (…) this chiasma, to grasp this inversion (Merleau-Ponty 1994:256).
Despite of all doubt, it actually does seem possible that out of the image can emerge something which is not image. Perception must loosen the outside-focus and somewhat perceive just that perception. It will then pass through, what Kamper calls, the souterrain of the image a passage which needs to be practiced nowadays, to be done again and again: encore/en corps.
The finale: one more catwalk. A solo.
The woman is dressed in her body-suit (or is the dress her body). She is wearing a red train made of a big lump of raw meat. Traces of blood, smell of decay. A strong metaphor weak again compared to the chiasma I felt before, but obviously strong enough to provoke my resistance.
Despite of the silence I hear in the performance space, I beginn to listenì to the image. I hear music from within my body: a cantata (I had heard quite some years ago) that Hans Werner Henze composed on a poem written by Arthur Rimbaud: Being beauteous. Performing the body as an imperfect.
german
tanzdrama 62
von Peter M. Boenisch
Der Körper als Zeichen!? >
Anmerkungen zur Analyse von Körper- und Bewegungsdarstellungen
Die 128 Zuschauer sitzen in zwei Reihen auf Fahrradsatteln um einen 15 Meter langen Laufsteg, auf dem drei asiatische Tänzerinnen agieren. Diese schreiten zunächst in gesteigerter Allmählichkeit am Publikum vorbei, das buchstäblich hautnah dabei ist: Man nimmt das Parfum der Tänzerinnen wahr, ein Luftzug streicht über das Gesicht, wenn die Drei in ihren weißen Mänteln vorüberziehen oder eine standbildhafte Pose einnehmen. Immer wieder blicken sie einem (oder einer) direkt in die Augen, geben stehend, gehend und auf dem Boden agierend den Blick auf ihre Körper frei; Blicke, denen die Zuschauer oft lieber ausweichen, meist mit freundlichem Lächeln. Die späteren, zunehmend schnelleren Aktionssequenzen spielen sich ebenso direkt vor den Augen des Publikums ab: Kaum eine Armlänge entfernt marschiert das Trio auf seinem erhöhten Plateau im Laufschritt vorbei, plötzliche Fuß- und Handaktionen stoppen oft keine Handbreit vor der Nase der Zuschauer. Wiederholt treten die Tänzerinnen von der Bühne ab, indem sie sich inmitten des Publikums vom Laufsteg herabschlängeln und unter den Podesten verschwinden.
„see and be scene“, das hier beschriebene Stück der Berliner Choreografin Helena Waldmann, mag somit als Beleg für einen populären Topos der zeitgenössischen Theaterwissenschaft erscheinen: So muss es aussehen – jenes Theater der Unmittelbarkeit, das den akademischen Analysten mit phänomenologischen, „in-der-Welt-seienden“ Körpern konfrontiert: mit dem blauen Fleck am Unterschenkel einer Tänzerin, dem Pflaster am großen Zeh ihrer Kollegin, der – hier sei die sprichwörtlich gewordene Beobachtung einer Theaterwissenschaftlerin in einem anderen Stück aufgegriffen – Warze am „Leib“ des Schauspielers Josef Bierbichler.
Nachdem die Theatersemiotik in Ungnade gefallen ist, entdeckte die gegenwärtige deutsche (vor allem: Sprech-)Theaterwissenschaft derart einen neuen, tatsächlich freilich uralten Gegenpol des Reichs der Zeichen: die präsente statt repräsentierte, phänomenologische statt semiotische Seite des Theaters und der dort auftretenden Körper – eben die blauen Flecken und Warzen. Tanzkennern mag dieser phenomenological turn umso bemerkenswerter erscheinen, als für den Tanz das Spiel mit Körperlichkeit auf der Bühne alles andere als eine aufregende Neuentdeckung darstellt. Ein vergleichbarer Mythos des „ursprünglichen Leibes“ jenseits von Zeichen, Maschinen und Sprache (erst recht der analytischen) durchlebte bereits das vergangene Jahrhundert der Tanzwissenschaft – und ist trotz körperkritischer Choreografen wie William Forsythe noch immer nicht ausgestorben. Auch gegenwärtig bleiben tanzanalytische Forschungen mit Titeln wie „Tanz als BewegungsText“ weitgehend ignoriert. So treffen sich (auch wenn sie selten miteinander reden) traditionalistische Tanz- und am Puls der Theoriezeit argumentierende Sprechtheaterexperten am gemeinsamen akademischen Stammtisch. Wer da mit semiotischen Ideen antritt, wird verlacht wie einer, der mit Marx unter’m Arm darüber sinniert, dass die DDR zuweilen doch auch Vorzüge aufweisen mochte.
An dieser Stelle soll keine Polemik gegen die modische theaterwissenschaftliche Vulgärphänomenologie betrieben werden. Es mag der Hinweis genügen, dass ein seit Jahrzehnten konstatiertes Forschungsdesiderat weder von der Theatersemiotik der 1980er-Jahre noch von den Körper-Inszenierungs-Debatten der Gegenwart erfüllt werden konnte: Noch immer entziehen sich auf der Bühne bewegende Körper einer präzisen Analyse – obgleich zeitgenössische Tanz- und Körper-Performances von Robert Wilson bis Xavier Le Roy und Jérome Bel längst zum Lieblingsspielzeug der Theaterwissenschaft geworden sind. Anstatt die Praxis dieser und anderer Körperperformer ertragreich zu erhellen, stellen die Auseinandersetzungen mit ihren Inszenierungen selten mehr als theoretische Gedankenspiele dar, in denen eine konkrete Analyse allenfalls der assoziativen Entfaltung des postmodernen akademischen Diskurses in die Quere käme. Im Folgenden sei ein Lösungsvorschlag für das skizzierte analytische Defizit unterbreitet, der noch ketzerischer als die bis hier formulierte Kritik erscheinen mag: wird doch einer semiotischen Analyse das Wort geredet und dieser Ansatz als ein auch angesichts hybrider multimedialer Theaterformen des 21. Jahrhunderts taugliches Analyseinstrument von Körper-Zeichen im Sprech-, Tanz-, Musik- und Performancetheater vorgestellt.
Die Besonderheiten theatraler Zeichensysteme
Dazu ist zunächst der hier zu Grunde gelegte Zeichenbegriff zu explizieren, da er – kaum überraschenderweise – von den Konzepten der traditionellen Theatersemiotik differiert, die sich in ihrer Theoriebildung stark an die im linguistischen Kontext entwickelte klassische Zeichentheorie des frühen 20. Jahrhunderts anlehnte. Der hier vorgestellte reformierte semiotische Ansatz hingegen nimmt eine grundlegende Unterscheidung zwischen alltagsweltlichen Zeichensystemen und künstlerischen Codes wie dem Theater vor, die grundlegend anderen Gesetzen unterliegen. Erstere sind Teil einer funktional ausgerichteten Zeichenökonomie – beispielsweise die alltägliche Sprache oder Verkehrszeichen. Jedem Zeichen ist dabei kraft Konvention eine möglichst eindeutige Bedeutung zugeordnet, die von jedem Rezipienten auf gleiche Weise ‚richtig’ dekodiert werden muss. Diese Art der funktionalen, alltagsweltlichen Kommunikation ist somit als Übertragung eines finiten Bedeutungsproduktes zwischen ‚Sender’ und ‚Empfänger’ dieser Botschaft zu beschreiben. Konventionalität und maximale Disambiguität ermöglichen es dabei, die Bedeutung eines Zeichens exakt in einem Lexikon zu erfassen. Im direkten Gegensatz dazu sind künstlerische, performativ-liminoide Zeichensysteme wie das Theater gerade nicht konventionalisiert und demzufolge auch nicht lexikalisierbar: Eine bestimmte Körperaktion als theatrales Zeichen kann in verschiedenen Inszenierungen, der Semiotiker spricht von verschiedenen syntagmatisch-kontextuellen Verknüpfungen dieses Zeichens, eine jeweils grundsätzlich andere ‚Bedeutung’ bekommen. Da der Begriff Bedeutung aber, wie in der Alltagskommunikation, eine hier gerade nicht zutreffende finite Produkthaftigkeit impliziert, soll der geeignetere Begriff der Signifikation künstlerischer Zeichen eingeführt werden. Diese ist niemals getrennt von ihrem aktuellen Gebrauch analysierbar: Theatrale, künstlerische Kommunikation stellt sich somit als systemischer Prozess dar, an dem ‚Sender’ wie ‚Empfänger’ gleichermaßen beteiligt sind.
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass Lektüre- und Analysestrategien, die an einem essenziell funktionalen Zeichensystem wie der Sprache entwickelt wurden, keineswegs ohne weiteres auf solche künstlerische Signifikationsprozesse übertragbar sind. Gerade theatrale Körperaktionen sind als auf der Bühne präsentierte Körperzeichen befreit vom gewohnten alltagsweltlichen Verhalten des Körpers und dessen Limitationen. Entsprechend erfasste die bloße Übertragung etwa soziologischer Verhaltensmodelle auf das Bühnenverhalten von Figuren allenfalls optionale Aspekte des Signifikationspotenzials von Körperzeichen. Schlimmstenfalls gäben spezifische historische Ausformungen von Bühnen-Körperkonzepten ein (nicht selten gar allgemeingültig verstandenes) analytisches Schnittmuster ab – im Regelfall das westeuropäische, bürgerliche, realistische, dramatische Theater seit der Aufklärung und den Körperdebatten des 18. Jahrhunderts. Gerade zeitgenössische Körperzeichenkonzepte, die sich dem klassischen Realismusparameter bewusst entziehen, würden im Licht derartiger Analysemodelle automatisch defizitär erscheinen, ohne dass ihr realisiertes Signifikationspotenzial auch nur annähernd erfasst wäre.
Wo sich Zeichen im künstlerisch-theatralen Kontext somit grundsätzlich anders verhalten als gewohnte alltagsweltliche Zeichen, bedeutet dies aber nicht, dass sich semiotische Analysekonzepte als a priori untauglich erwiesen – im Gegenteil. Hier ist eine weitere zentrale Basisthese des vorgeschlagenen Zeichenkonzepts zu berücksichtigen: Auf der Bühne präsentierte Körper- und andere Aktionen und Objekte werden als stets intentional gesetzte und essenziell dekodier- und interpretierbare Informationen aufgefasst – es handelt sich somit sehr wohl um Zeichen. Zur Erläuterung sollen die beiden wesentlichen Mitspieler theatraler Zeichenproduktion genauer betrachtet werden: der ‚Sender’ oder Produzent der Zeichen – also der Künstler, Autor, Regisseur, Choreograf… – sowie der ‚Empfänger’ oder Rezipient, also der Zuschauer genau wie der wissenschaftliche Analyst. Während der Zeichenproduzent im alltagsweltlichen Kontext eine finite Bedeutung mittels einer vielfach redundanten Zeichenkette zu vermitteln sucht, sind im künstlerischen Kontext alle Zeichen von ihm intentional gesetzt. Dies bedeutet gerade nicht mehr, dass der Künstler seinem Artefakt eine (‚richtige’) Bedeutung einpflanzt, welche die Interpretation zu rekonstruieren habe. These ist allein, dass etwa im Rahmen einer Inszenierung nichts zufällig passiert, sondern jedes Zeichen intendierte, an den Rezipienten gerichtete Information darstellt. Jedes dieser Zeichen ist somit essenziell interpretierbar, d.h. nichts in einer Inszenierung ist sinnlos. Der künstlerische Kommunikationsprozess wird somit erst durch diese Interpretation des Rezipienten komplett: Dabei schlägt sich der Betrachter seinen eigenen, durch die vorausgegangene Setzung gleichwohl inter-subjektiven Pfad durch das Zeichennetz einer Inszenierung.
Auf der Basis dieses Zeichenverständnisses erweist sich – auch und gerade in Bezug auf Körperzeichen – die Unsinnigkeit des grassierenden Unmittelbarkeitsdogmas. Schließlich gilt stets: „there is no performance without pre-formance“. Diverseste Körpertechniken, wie sie in der Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts etwa im mime corporel Etienne Decroux, in den formalen Körperarchitekturen Robert Wilsons und den extremen Aktionen des Tanztheaters der 1980er Jahre (etwa von Choreografen wie Wim Vandekeybus und Lloyd Newson) entwickelt worden sind, verweisen durch eine auf je spezifische Weise angewandte radikale Atomisierung und nachfolgende Rekombination des Körpers der Akteure aus verschiedensten Perspektiven auf die nämliche, in unserem oben explizierten Sinne ‚gesetzte’ Basis des Bühnenkörpers, die ihn auf fundamentale Weise vom ‚realen’ Körper (oder gar: Leib) der Akteure unterscheidet. Von den zahlreichen, in der allgemeinen Theatertheoriebildung konsequenzlos gebliebenen Beschreibungen jenes Null- und Ausgangspunktes von KörPERformance seien exemplarisch Eugenio Barbas Konzept des „pre-expressive body“ und Richard Schechners „restored behaviour“ angeführt. Weder Schauspieltheorien des 20. Jahrhunderts (etwa Brecht oder Grotowski) und erst recht nicht die Performance Art der 1960er Jahre sind als Kontraargument tauglich. Phil Auslander streitet in einer an Derrida geschulten Argumentation sogar jeglicher Äußerung des Körpers das Potenzial unvermittelter Präsenz ab:
The body is no more purely present to itself than is the mind and is therefore no more autonomous a foundation for communication than is verbal language. […] Pure self-exposure is no more possible on a physical level than on a verbal level because of the mediation of difference.
Der auf der Bühne agierende Körper ist somit weder Manifest unmittelbarer, unhintergehbarer natürlicher Leiblichkeit noch – entsprechend der klassischen Semiotik – als Signifikant ein Träger unmittelbar ablesbarer Bedeutungen. Mit den angeführten Atomisierungsstrategien wiesen die experimentellen Körperperformer des 20. Jahrhunderts den Weg für adäquate Konzeptionen der Analyse. Demnach ist jedes Körperzeichen als nicht mehr denn ein gewissermaßen atomisierter Datenbit aufzufassen, der isoliert betrachtet allein hinsichtlich des Merkmals vorhanden/nicht vorhanden spezifiziert ist. Von diesem Zeichen lässt sich keine eindeutige Bedeutung ablesen, wohl aber vermittelt es Information. Dieser im Kontrast zum starken Konzept der repräsentativen Zeichenbedeutung, wie es dem traditionellen sprachorientierten Semiotikmodell eingeschrieben ist, wesentlich schwächere Begriff ist zentral. Die gerade für elektrONische Kulturtechnologien charakteristische binäre 0/1-In-Formation des Zeichens fusioniert jegliche Form-/ Inhaltdistinktion und frustriert derart die traditionelle, allein auf das funktionale Ziel von Repräsentation ausgerichtete semiotische Lektüre. Statt Repräsentation sind allein Attraktion und verlinkende Assoziation semantische Aufgaben des einzelnen Zeichen-Bits. An Stelle eines eindeutigen repräsentativen Verweises (der nach wie vor Option bleibt, aber nicht mehr als alleinige Aufgabe des Zeichens verstanden wird!) legen die (Körper-) Zeichen die Basis für ein vielschichtiges signifikatorisches Potenzial, das nicht länger als bloße additive Summierung der in jedem einzelnen Körperzeichen vermittelten Bedeutung aufzufassen ist.
Hier setzt das skizzierte Analysemodell an, das diesen Signifikationsprozess künstlerischer Zeichen gemäß der vier heuristischen Parameter Konstitution, Konkatenation, Signifikation und Interpretation beschreibt. Auf der grundlegenden Ebene der Konstitution wird dabei jene den Körperaktionen und Figurationen eingeschriebene (derart ‚konstitutive’) Basis-Information mit Hilfe einer Handvoll entsprechender Basisparameter untersucht. Eine überaus brauchbare Grundlage bildet dazu die Terminologie der Laban’schen Körperanalyse mit ihren Konzepten von Raum- und Kinesphärennutzung, Effortfaktoren usf., die sich nicht nur in der Tanzanalyse, sondern auch im Sprech- und selbst Musiktheater bewährt. Über seine konkatenative Verknüpfung ist jedes dieser einzelnen Zeichen in ein non-lineares syntagmatisches Netzwerk integriert, das die Informationsparameter der einzelnen Zeichen miteinander verschaltet und somit grundlegend für das postulierte kontextbasierte Signifikationspotenzial ist. Das einzelne Zeichen fungiert als ein querverweisender Link innerhalb der simultan präsenten Oberfläche dieses gesamten semantischen Netzwerks der Inszenierung. Der Zuschauer/Analyst hat dabei keinesfalls in hermeneutischer Sisyphosarbeit das komplette Informations-Netzwerk zu entdecken, analysieren und verstehen; vielmehr schaltet im Prozess der Interpretation – wie erwähnt – jeder Rezipient seine individuellen Links durch dieses semantische Web, dessen gesetzte Zeichen mit ihren verifizierbaren konstitutiven Informationen und konkatenativen Relationierungen die Inter-Subjektivität dieser Lektüre garantieren. Im Unterschied zur traditionellen Konzeption von ‚Bedeutung’, die Produkthaftigkeit, Lexikalisierbarkeit, Exaktheit, Korrektheit (…) suggeriert, stellt künstlerische Signifikation einen fließenden systemischen Prozess dar, der weder abschließbar noch exhaustiv erfassbar ist. Anstelle vom Inszenierungs-„Text“ kann somit auch anschaulicher vom „Hypertext“ einer Aufführung die Rede sein. ‚Bedeutung’ wird von der ablesbaren, gewissermaßen identitätsstiftenden Eigenschaft eines Zeichens, die sich in einem Lexikon festschreiben ließe, zum Ergebnis der jeweils vorgenommenen interpretativen Zeichenlektüre. Ein solcher Signifikationsprozess muss infinit sein, da in der permanenten Neuverschaltung das gesamte semantische Potenzial der aktualisierten Zeichen non-hierarchisch kopräsent bleibt: Somit ist es alles andere als ein Mangel, dass es nie die letztgültig ‚richtige’ Interpretation einer Inszenierung geben wird. Die Analyse künstlerischer Zeichensysteme betreibt somit, was Diedrich Diederichsen als „postmoderne Aufklärung“ beschreibt: Sie führt auf kein Ziel, kein Original, keinen Grundtatbestand, keine Basis und auf keine letzte Instanz zu. Ein ewig laterales Apropos verknüpft alle Gegenstände der Welt als immer schon Kunstgegenstände, Kunstwerke und Bedeutungsspeicher endlos miteinander. Zu allem fällt uns eine andere Fernsehserie, ein anderes Kunstwerk, eine berühmte Kameraperspektive, ein abgehalfterter Star, ein berühmter Satz sowie deren Verkehrungen, Verdichtungen, Verfremdungen etc. ein.
Die derart assoziative Verlinkung schaltet dabei nicht nur imitative oder metaphorische Verweise in andere kulturelle Zeichenrepertoires, sondern verhandelt auf reflexiver Meta-Ebene auch das eigene Zeichensystem und den eigenen theatralen Code.
See and be scene. Interpretatorische Pfade durch Helena Waldmanns Choreografie.
Die Tanzperformance von Helena Waldmann demonstriert diese künstlerischen Signifikationsstrategien auf exemplarische Weise. Die zentrale thematische Verknüpfung des Stückes belegt bereits der Titel: see and be scene, zu lesen auch als „(die Bühne) sehen und (auf der) Bühne sein“ – nicht zuletzt unter semiotischer Perspektive auch: (Körper-)Zeichen produzieren und rezipieren. Das in zahlreichen Rezensionen aufgegriffene Motiv des Zuschauers als Voyeur trägt dabei allenfalls die signifikatorische Oberfläche ab.
Bereits die Bühnenkonzeption bringt weitere Spiegelungen des Grundthemas „Sehen“ zum Vorschein: Das Publikum sitzt am Laufsteg wie an einem Tisch. Vor jedem liegt ein Spiegel, den die Zuschauer nach Belieben nutzen können. Im Unterschied zu traditionellen Theatervereinbarungen gibt es in diesem Raumkonzept keinen einheitlichen Fluchtpunkt: JedeR kann und vor allem darf sehen, was und wohin er/sie will. Überdies hängt, gleichsam als Dach, eine weiße Projektionsfläche über der Bühne, deren Abmessung den Laufsteg spiegelt. Dort erscheinen Videobilder, die ihrerseits von Projektoren zunächst auf seitlich hinter den Zuschauerreihen installierte Spiegel gestrahlt werden, von wo aus sie erst auf diese Leinwand reflektieren. Der Gegensatz von „leibhaftig“ agierenden und medial vermittelten Körpern ist somit explizit in Szene gesetzt. Allerdings ist Waldmann weit davon entfernt, Partei für eine Seite zu ergreifen, auch und erst recht nicht für die direkt vor den Augen des Publikums „in-der-Welt-seienden“ leiblichen Körper. Stattdessen dekonstruiert sie die unproduktive Dichotomie von entweder Semiotik oder Phänomenologie. Auch diese vermeintlich konträren Polaroppositionen entlarvt sie als vielfach ineinander verschaltet. Was hinter und unter den weißen Mänteln steckt, welche die Tänzerinnen eingangs tragen, ist nur eine weitere bespiegelte Projektionsfläche – genau wie die leblose Leinwand, die über der Bühne hängt. Knöpfen die Tänzerinnen die Mäntel auf, ‚tragen’ sie Körper: auf ihren hautfarbenen Anzügen, Shirts und Hosen (gestaltet von der italienischen Medienkünstlerin Alba D’Urbano) sind ‚ihre’ Körper aufgedruckt: Falten, Brüste, Schamhaar. Ziehen die Tänzerinnen die Jacketts aus, erscheint darunter das nächste Shirt mit aufgedrucktem Körper. Diese Körperhüllen lassen sich problemlos untereinander austauschen, was die Akteure in der Mitte des Stückes tatsächlich tun. Der scheinbar unmittelbar vor den eigenen Augen greifbare Körper entzieht sich so jeglicher Greifbarkeit: Helena Waldmann inszeniert Bodiescapes: präsent(iert)e Körper, die einem logisch-analytischen Zugriff entkommen, die sich statt gegenwärtig zu sein in permanentem Fluss befinden. Noch bevor die Körper aus Fleisch und Blut die Bühne betraten, zeigten die von der polnischen Videokünstlerin Karina Smigla-Bobinski gestalteten Projektionen fließende Wassertropfen, in denen die Körper der Akteure einkopiert waren. Blut ist im finalen Bild nur auf der Videoprojektion zu sehen, während eine Tänzerin behängt mit veritablen, riesigen Fleischstücken über die Bühne läuft. In den 60 Minuten dazwischen sind Körper längst zerflossen: Was bleibt, sind Zeichen.
Deren Präsentation stiftet ein Zeichennetz aus Assoziationen und Isotopien, das sich nicht mehr zur homogenen Repräsentation schließt: diese ist genauso wie psychologischer Bühnenrealismus als nicht mehr denn eine signifikatorische Optionen anerkannt, mit denen im künstlerischen Zeichenkontext spielerisch andere Präsentationsmodi simultan konkurrieren. Die Bedeutung von see and be scene lässt sich am Ende nicht aus analytisch isoliert examinierten Körperaktionen ablesen wie aus einem Buch; sie ergibt sich erst in der von jedem einzelnen Rezipienten geleisteten Verschaltung aller präsentierter Zeichen dieser Inszenierung zu einem signifikatorischen Netzwerk, das diverseste kulturelle Praktiken auch weit außerhalb der aktuellen Aufführungssituation miteinander kurzschließt. Das Szenario des Stückes erinnert dabei ebenso an eine Modenschau wie an eine gemeinsame Banketttafel („a catwalk banquet“ lautet der Untertitel). Wo die Tänzerinnen haut- und hauchnah vor den Augen der Zuschauer posieren, scheint wiederum das Motiv der Peep-Show auf; der militärische Drill im synchronen Marsch des Trios verlinkt später das Catwalk-Motiv mit militärischem Exerzieren. Die Akteure führen schließlich vor einigen Zuschauern kniend eine japanische Teezeremonie durch: Das Zeremoniell bleibt aber genauso leer wie die Tassen. Dennoch korrigieren die Akteure sorgfältig jeden Fehler der Zuschauer im Ritual, etwa beim Drehen der Tassen. Der Körper ist ohne einen Betrachter und dessen (Be)Spiegelung ein leerer Haken, eine ungefüllte Tasse; trotzdem kultivieren wir Körperzeremonien, die – so wird am Rande deutlich – alles andere als ein korrektives Gegengift zum grassierenden Cyberhype virtueller Welten sind.
Der Zuschauer ist bei all dem Voyeur – nicht zuletzt seiner selbst – wie auch und vor allem Akteur, der aktiv durch dieses Zeichennetz navigiert und sich dabei seiner interaktiven Rollen bei der Sinnzuschreibung bewusst ist, bzw. mit allen Mitteln auf dieses Bewusstsein gestoßen wird. Dieses Navigieren im semantischen Netz, das aktive Schalten von Links innerhalb des signifikativen Potenzials der Inszenierung verhindert, dass sich die (auch und gerade analytische) Rezeption an banalen Oberflächlichkeiten wie etwa Warzen oder rein intellektuellen Turnübungen (etwa durch einen Pavlov’schen Lacaneffekt, sobald nur ein Spiegel im Bühnenraum hängt) abarbeitet. Eine kritische Interpretation wird zum unverzichtbaren Bestandteil der Aufführung, die ohne solche aktive Nachfrage nach dem aufgespannten Bedeutungsangebot unbelebt und blutleer bleibt. Es ist Aufgabe der Theoriebildung, diese kritische Nachfrage zu fördern und mit geeigneten Konzepten anzuleiten. Wo hingegen nur akademische Ideologien und inzestuöse Denkspiralen willkürlich gesetzte Leitdiskurse perpetuieren, wird diese Theorie immer von der Praxis überholt bleiben. In der Tat, um die Zukunft des Theaters braucht man sich nicht zu sorgen: Helena Waldmanns Stück verschaltet geradezu musterhaft Performance, Kunst und Alltag auf untrennbare Weise. Eine starke selbstreflexive Ebene führt nicht dazu, dass vor lauter Theorie der Alltag aus dem Blick gerät: Obgleich, ja gerade weil in diesem Stück nichts realistisch ist, sind Tanzperformances wie „see and be scene“ am weitesten vom künstlerischen Elfenbeinturm entfernt, in den sich – da nicht nur auf akademischer Seite manches im Argen liegt – auch zahllose zeitgenössische Regisseure, Performer und Dramatiker zurückziehen, auch wenn sie dabei gerne ihre Freundescliquen zu Partyzwecken mitnehmen. Bei Waldmann zeigt sich, dass nicht antiquiertes Beharren auf Konzepten wie „Echtheit“ und „Präsenz“, sondern gerade das Kreieren und Präsentieren solcher alienatorischer Zeichenwelten, die artifizielle Bühnenrealität und konkrete Alltagserfahrungen in einer liminoiden Grauzone kurzschließen und dabei beide Zeichenökonomien gleichermaßen verfremden, am Ende gar die marginalisierte Institution des Theaters zu einem Brennpunkt kultureller Sinnproduktion machen kann, die im künstlerischen Kontext nicht nur funktionalistische Verwertungsgesetze des Alltags schleifenhaft perpetuiert. Die Bedeutung des (Er)Lebens solcher auch dissidenter Alternativen kann in einer Zeit, in der Kritik wieder als (patriotisches, was immer) Sakrileg sanktioniert wird, nicht stark genug hervorgehoben werden.
Literatur
Auslander, Philip: From Acting to Performance. London u.a. 1997.
Barba, Eugenio/Savarese, Nicola (eds.): The Secret Art of the Performer. London 1991.
Boenisch, Peter M: körPERformance 1.0. München 2002.
Diederichsen, Diedrich: “Die Simpsons der Gesellschaft” – In: SPEX 1/1999, S. 40-42
Jeschke, Claudia: Tanz als BewegungsText. Unter Mitarbeit von Cary Rick. Tübingen 1999.
Kershaw, Baz: The Politics of Performance. London u.a. 1992
Laban, Rudolf von: The Mastery of Movement. Revised by Lisa Ullmann. Fourth Edition/Reprint. Plymouth 1988.
MacAloon, John J. [ed.]: Rite, Drama, Festival, Spectacle. Philadelphia 1984.
McFee, Graham: Understanding Dance. London u.a. 1992.
Schechner, Richard: Between Theatre and Anthropology. Philadelphia 1985.
Turner, Victor: From Ritual to Theatre. New York 1982.
Vanden Heuvel, Michael: Performing Drama/Dramatizing Performance. Ann Arbor 1993.
Links
see and be scene
Running order >
Technical Rider
german